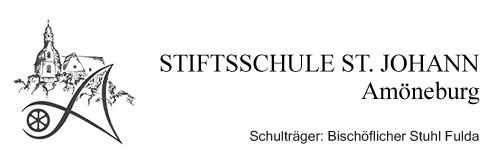„Soldat im Zwiegespräch mit einem Grashüpfer“
Stabsgefreiter Johannes Clair berichtet aus seinem Einsatz in Afghanistan
 |
Inzwischen sind es viele tausend Männer und Frauen, die als Bundeswehrsoldaten im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland und der UNO, die „Sicherheit Deutschlands am Hindukusch“ verteidigt haben. Johannes Clair, gebürtig aus Wiesbaden und heute Student in Hamburg, ist einer von ihnen. Er ist einer von wenigen dessen Name und Erlebnisse mehr als nur dem persönlichen Umfeld bekannt geworden sind, weil er ein Buch über die Zeit seines Einsatzes im Norden Afghanistans 2010 und 2011 geschrieben hat. „Vier Tage im November“ gewährt Einblicke in ein Land und einen militärischen Einsatz aus der Perspektive eines einfachen Soldaten.
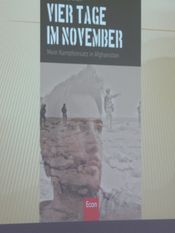 |
Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe Q2 waren zu einer Autorenlesung mit anschließender Diskussion eingeladen. Präsentiert bekamen sie einen informativen und anschaulichen Vortrag, in dem Johannes Clair versuchte den Schülerinnen und Schülern sowohl das Land Afghanistan, seine Geschichte, Kultur und die dort lebenden Menschen näher zu bringen, als auch das Alltagsleben und die Ängste und Probleme eines Soldaten im Einsatz möglichst authentisch wiederzugeben.
Die gebannte Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler machte deutlich, dass Clair in seiner lockeren, aber nicht unernsten Erzählweise, die Schüler zu fesseln wusste. Geradezu Banalitäten waren es, die der Buchautor erzählte, die dazu führten, dass die Zuhörer sehr schnell einen Zugang zur unbekannten Thematik fanden. So berichtete er zum Beispiel von dem Problem, dass neben den asiatischen Fernsehprogrammen, nur ein europäischer Sender zu empfangen war: Polnisches Viva. Geradezu greifbar wurde auch die Enge in den Unterkünften im Feldlager oder die spartanischen Bedingungen mit denen die Soldaten klarkommen mussten und müssen. Damit hier das soziale Miteinander funktioniert, sind Regeln strikt zu befolgen, was aber aus Sicht von Clair auch mit absurden Befehlen einhergeht oder aber die Einsatzbedingungen trotz Einhaltung aller Regeln zu Konflikten führen können. So berichtete Clair vom nicht nachzuvollziehenden Befehl, dass im Feldlager der Müll strikt getrennt werden muss, obwohl klar war, dass auf der Müllkippe vor dem Lager alles wieder zusammengeworfen wird. Streit gab es zum Beispiel regelmäßig in einem Vorposten außerhalb des Feldlagers, der mit 30 bis 40 Mann besetzt war, aber nur über eine Klimaanlage verfügte, die nicht geeignet war bei 40 Grad Celsius genügend Soldaten etwas Kühlung zu verschaffen.
 |
In solchen und anderen Situationen sei dann Improvisation gefragt, wie zum Beispiel durch das Aufstellen eines Kinderplanschbeckens, was half, die Situation und Konfliktträchtigkeit etwas zu entspannen. Langeweile oder der Konkurrenzkampf mit Mäusen und Ratten ums Essen waren andere Alltagsprobleme gegen die die Soldaten Strategien entwickeln mussten.
So sehr diese Erfahrungen im jeweiligen Moment als Belastung wahrgenommen wurden, so „harmlos“ stellen sie sich in der Rückschau und im Vergleich mit anderen langfristig prägenden und Situationen und Erlebnissen dar. Für viele Soldaten sei dies beispielsweise die Ungewissheit darüber, ob man den afghanischen Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, vertrauen könne oder ob sie mit Kriminellen oder Taliban zusammenarbeiten. Clair legt auf die Feststellung wert, dass er den Menschen für ihr Verhalten keinen Vorwurf macht, denn die meisten handelten gegen die ISAF-Soldaten nur aus eigenem Überlebenswillen heraus, weil sie selbst oder ihre Familien bedroht würden. Bei ihm habe diese Situation dazu geführt, dass er im Laufe der Zeit immer mehr Angstgefühle bekommen habe. Längere Zeit habe er hiermit jedoch irgendwie klarkommen können und weiter „funktioniert“. Schluss war jedoch damit, als er mit seiner Einheit in einen Hinterhalt gelockt worden sei und sie „Vier Tage im November“ (Buchtitel) unter Dauerbeschuss gestanden hätten. Hier habe er nicht mehr normal reagieren und handeln können. Es sei ihm beispielsweise nicht mehr möglich gewesen seiner Aufgabe, dem MG-Schützen das Gewehr aufzumunitionieren, nachzukommen. Stattdessen habe er sein Handy genommen und gefilmt oder sich eine halbe Stunde lang mit einem Grashüpfer unterhalten.
Für Clair waren diese vier Tage in der Ungewissheit, ob man lebend herauskommen würde, zu einem Schlüsselereignis geworden. Er habe vor der Entscheidung gestanden seinen Einsatz zu beenden oder ihm einen neuen Sinn zu geben. Schließlich waren es „Fußbälle“, die seiner verbleibenden Zeit in Afghanistan einen Sinn gaben. Der Soldat schrieb verschiedene Sportartikelhersteller an und bat sie um entsprechende Spenden. Gespendete Fußbälle, Trikots und Schuhe schenkte er dann in den Dörfern den dortigen Kindern.
Welches Fazit zieht der Soldat nach seinem Einsatz? Bereut er seinen Einsatz?
Hatte Clair Probleme wieder ins Zivilleben zurückzukehren?
Info-Box:
© Stiftsschule St. Johann Amöneburg